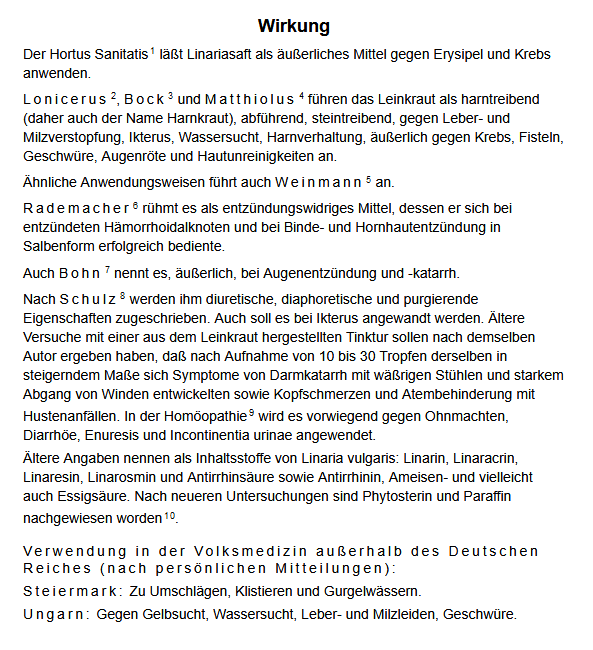
Wirkung
Der Hortus Sanitatis1 läßt Linariasaft als äußerliches Mittel gegen Erysipel und Krebs anwenden.
Lonicerus2, Bock3 und Matthiolus4 führen das Leinkraut als harntreibend (daher auch der Name Harnkraut), abführend, steintreibend, gegen Leber- und Milzverstopfung, Ikterus, Wassersucht, Harnverhaltung, äußerlich gegen Krebs, Fisteln, Geschwüre, Augenröte und Hautunreinigkeiten an.
Ähnliche Anwendungsweisen führt auch Weinmann5 an.
Rademacher6 rühmt es als entzündungswidriges Mittel, dessen er sich bei entzündeten Hämorrhoidalknoten und bei Binde- und Hornhautentzündung in Salbenform erfolgreich bediente.
Auch Bohn7 nennt es, äußerlich, bei Augenentzündung und ‑katarrh.
Nach Schulz8 werden ihm diuretische, diaphoretische und purgierende Eigenschaften zugeschrieben. Auch soll es bei Ikterus angewandt werden. Ältere Versuche mit einer aus dem Leinkraut hergestellten Tinktur sollen nach demselben Autor ergeben haben, daß nach Aufnahme von 10 bis 30 Tropfen derselben in steigerndem Maße sich Symptome von Darmkatarrh mit wäßrigen Stühlen und starkem Abgang von Winden entwickelten sowie Kopfschmerzen und Atembehinderung mit Hustenanfällen. In der Homöopathie9 wird es vorwiegend gegen Ohnmachten, Diarrhöe, Enuresis und Incontinentia urinae angewendet.
Ältere Angaben nennen als Inhaltsstoffe von Linaria vulgaris: Linarin, Linaracrin, Linaresin, Linarosmin und Antirrhinsäure sowie Antirrhinin, Ameisen- und vielleicht auch Essigsäure. Nach neueren Untersuchungen sind Phytosterin und Paraffin nachgewiesen worden10.
Verwendung in der Volksmedizin außerhalb des Deutschen Reiches (nach persönlichen Mitteilungen):
Steiermark: Zu Umschlägen, Klistieren und Gurgelwässern.
Ungarn: Gegen Gelbsucht, Wassersucht, Leber- und Milzleiden, Geschwüre.