Nein! Samuel Hahnemann ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht zum Albert Einstein der Medizin geworden. Trotzdem haben die beiden mehr gemeinsam als nur einige biographische Daten (2005 = 250. Geburtstag Hahnemanns, 50. Todesjahr Einstein, 100. Geburtstag der speziellen Relativitätstheorie): Beide versuchten, mit großem Engagement ihre jeweiligen Fachgebiete angesichts längst überholter Theorien zu “dynamisieren”, einen frischen Wind wehen zu lassen. Beide erlitten tiefe Brüche in ihren Biographien, sei es der sozioökonomischen Verhältnisse, sei es der Herkunft wegen. Beide sind, eingebunden in die Entwicklungen ihres Faches, publikumswirksame Impulsgeber, die bis heute öffentlich präsent sind. Typisch für beide ist auch das teilweise bis völlige Unverständnis für ihr Werk beim Publikum – sinnleere Schlagwörter wie “Sanfte Medizin” oder “E=mc2″ vermitteln nichts von den tatsächlichen Gegebenheiten. Doch auch die Unterschiede sind bemerkenswert: Trotz der von Hahnemann verwendeten wissenschaftlichen Methodik, z. B. bei der standardisierten Arzneimittelprüfung bei Gesunden, die von der Schulmedizin erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingeführt wurde, gefährdet die Homöopathie anhaltend den Bestand der semi-naturwissenschaftlichen, in Wirklichkeit aber primär empirischen Medizin. Zu groß sind wohl die theoretischen Herausforderungen von Simileprinzip, Hochpotenz-Wirkung oder Miasmen-Lehre bis heute. Einsteins Werk hingegen ist umfänglich und nachhaltig zum Motor neuer Entwicklungen in Theorie und Praxis von Physik, Astrophysik oder Astronomie geworden. Als grobe Orientierung zu Leben und Werk von Hahnemann und Einstein präsentiert Heilpflanzen-Welt.de zu Beginn des kombinierten Hahnemann- und Einstein-Jahres 2005 einige biographischen Daten der beiden berühmten Deutschen.
Samuel Hahnemann
aus: Marcel Martiny: Geschichte der Homöopathie. In: Illustrierte Geschichte der Medizin. Hrsg.: Richard Toellner. Andreas & Andreas, 1986 (bei Amazon bestellen).
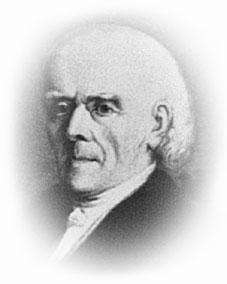
Samuel Hahnemann
Samuel Hahnemann … wurde am 10. April 1755 in Meißen an der Elbe, nördlich von Dresden, geboren. Sein Vater war Maler in der Porzellanmanufaktur. Er erreichte für seinen Sohn eine Freistelle an der Fürstenschule von St.-Afra. Inmitten der Junkerskinder, die mehr ihren Körper als ihren Geist pflegten, lernte der junge Samuel, der sowohl arm an Geld als auch an Muskeln war, schon bald eine Ungleichheit kennen, die jedoch keine Minderwertigkeit war. Seine organische und geistige Feinheit ließen ihn zur Überzeugung gelangen, daß er einer realeren Élite angehörte, nämlich jener der Geist-Arbeiter. Nach vorzüglichem Abschluss seiner Studien erreichte er von seinem Vater die Erlaubnis, Arzt zu werden. Er war entschlossen, an der Universität von Leipzig zu studieren. Bevor er die Schule verließ, musste er, wie es Sitte war, eine lateinische Abhandlung vorlegen: als Thema wählte er Über die menschliche Hand. Wie R. Larnaudie, einer seiner besten Biographen, berichtet, hatte Hahnemann die geistige Bedeutung der Hand erahnt, die Endpunkt und Synthese des Körpers, Verlängerung und Übermittler des Gedankens zur Handlung ist.
Hahnemann war ein armer Student und arbeitete in Leipzig voll Ausdauer Tag und Nacht, er führte ein enthaltsames und strenges Leben, ohne sich eine Zerstreuung zu genehmigen. Nach Beendigung des Studiums ging er nach Wien, um sich dort weiterzubilden. Er hatte das große Glück, Hausarzt des Statthalters von Siebenbürgen zu werden. Einige Monate lebte er untätig, im Überfluss und im Vergnügen. Während dieser unbeschwerten Zeit seiner Existenz ließ er sich als Freimaurer in die Wiener Loge der Drei Lotusse aufnehmen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Reaktion kam; er verließ seinen Prinzen, gab die Logentracht zurück und beschloss, ein echter Arzt zu werden. An der Universität von Erlangen reichte er seine Doktorarbeit ein über ein Thema, das unbewusst seine späteren Forschungen beeinflussen sollte, über die Erregbarkeit, den Krampf und die Sensibilität des Organismus mit dem Titel:
Conspectus adfectuum spasmodicorum aetiologicus et therapeuticus.
Im Alter von sechsundzwanzig Jahren heiratete er die Stieftochter eines Apothekers von Dessau; er hatte jedoch kein Verlangen, sich in dieser Kleinstadt anzusiedeln. Er ließ sich in der Gegend von Gommern nieder und führte das harte Leben eines Landarztes. Nach einiger Zeit beschloss er, in einer großen Stadt zu praktizieren und zog nach Dresden und gelangte dort ziemlich rasch zu allgemeiner Bekanntheit. Er begegnete Lavoisier, der in Dresden einen Vortrag über Phlogiston hielt. Vom Auftreten dieses rationalen wissenschaftlichen Materialismus bei der Untersuchung der Phänomene des Lebens war er sehr beunruhigt und eingenommen. Völlig von seinen Forschungen beansprucht, verließ er mit seiner Frau und seinen drei Kindern Dresden und zog nach Leipzig, der einzigen Universitätsstadt in Sachsen, in der Medizin gelehrt wurde.
Schon 1786 hatte er eine kleine Schrift über Arsenvergiftung, die Mittel zu ihrer Heilung und jene zu ihrer gerichtlichen Feststellung veröffentlicht. 1787 erschien die Abhandlung über die Vorurteile gegen die Steinkohlenfeuerung. 1789 brachte er den Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten und die Indikation eines neuen Quecksilberpräparates heraus. Zur selben Zeit publizierte er in den Annalen von Crell mehrere bemerkenswerte Arbeiten; unter anderem führte er Mittel zur Überwindung von Schwierigkeiten bei der Herstellung von Minerallaugensalz durch Pottasche und Kochsalz an. Er untersuchte den Einfluss gewisser Gase auf die Weingärung; er veröffentlichte chemische Untersuchungen über die Galle und Gallensteine. Er begann eine ganze Reihe von Arbeiten über die Möglichkeiten, dem Speichelfluss und den verheerenden Auswirkungen der Quecksilbervergiftung vorzubeugen.
1791 wurde er zum Mitglied der Ökonomischen Gesellschaft von Leipzig und der Akademie der Wissenschaften von Mainz berufen. Nach einem siebenjährigen Aufenthalt in Dresden kam er nach Leipzig zurück, dem Schauplatz seiner ersten mühevollen, oft nächtlichen Studien. Aber diesmal geht ihm der gute Ruf voraus, den ihm seine Arbeiten, seine Erfolge, seine wissenschaftliche Anerkennung und einige mächtige Freundschaften eingebracht haben. In diesem Lebensabschnitt erlebt er eine schwere Bewusstseinskrise.
Sein Warteraum war voll mit Patienten; er öffnete die Türe seiner Praxis, trat heraus und rief: “Meine Freunde, Sie können wieder gehen. Ich bin nicht in der Lage, Sie von Ihren Krankheiten und Ihren Schmerzen zu befreien; ich kann Ihnen nicht Ihr Geld stehlen.” Dieser Satz wurde stadtbekannt, zum großen Ärgernis, wie man sich denken kann, von Frau Hahnemann, die durch das Übermaß an Skrupel ihres Ehegatten dazu verurteilt war, mit ihren Kindern in völliger Not zu leben. Hahnemann arbeitete wieder als Abschreiber und Übersetzer. Er verbrachte seine Zeit mit dieser schlecht bezahlten materiellen Beschäftigung und seinen chemischen Untersuchungen, zu denen er sich von Tag zu Tag mehr hingezogen fühlte. Er musste eine zahlreiche Familie versorgen (seine Frau hatte ihm elf Kinder geschenkt); seine moralische Krise hatte ihm ungeheure materielle Sorgen verursacht. So lebte er von der Hand in den Mund und lud sich und jenen, die ihm am liebsten waren, bedeutende Entbehrungen auf. Jene, die sein Schicksal teilten, halfen ihm nicht, seine Last zu tragen. Seine Gattin konnte seine Zweifel nicht verstehen; lange Zeit plagte sie ihn mit Beschwerden, verfolgte ihn mit Vorwürfen und legte ihm alle möglichen Hindernisse in den Weg. All diesen Prüfungen stellte er seine Geduld entgegen und suchte nur in den Arbeiten und Forschungen Trost. 1792 publizierte er in Frankfurt das erste Heft eines Werkes mit dem Titel Freund der Gesundheit und im darauffolgenden Jahr den ersten Teil eines Apothekerlexikons. Zur gleichen Zeit gab er die wahre Zubereitung des Casseler Gelbs an, das sooft in den Künsten verwendet wird und dessen Zusammensetzung bis dahin geheimgehalten worden war. Seine Kinder wurden von schweren Krankheiten befallen. Nun erreichten seine Zweifel, seine Bedenken den Höhepunkt. Der Vater zitterte für das Leben der Seinen; der Arzt hatte kein Vertrauen zu den Mitteln der Medizin. Wäre es denn möglich, fragte sich Hahnemann, daß die Vorsehung den Menschen, seine Schöpfung, einfach im Stich gelassen hat ohne eine wirkliche Hilfe gegen die Vielzahl von Gebrechen, die ihn ständig belagern? Warum, so fragte er sich, hat man nicht schon seit zwanzig Jahrhunderten, seit es Menschen gibt, die sich Ärzte nennen, ein besonderes Mittel für jeden Krankheitsfall gefunden? Wahrscheinlich deshalb, weil es uns zu nahe liegt und zu einfach ist, denn man braucht dazu weder brillante Trugschlüsse noch verlockende Hypothesen. So begann er darüber nachzudenken, wie Medikamente auf den menschlichen Körper wirken, wenn dieser scheinbar bei bester Gesundheit ist. Die Veränderungen, welche sie hervorrufen, können nicht nutzlos sein, sie müssen sicherlich etwas bedeuten; wenn nicht, warum würden sie dann stattfinden? Er fragte sich, ob Medikamentenvergiftungen nicht die einzigen Ausdrucksmöglichkeiten seien, durch welche Heilmittel dem Beobachter den Zweck ihres Vorhandenseins vermitteln könnten.
Dieser einfache, aber tiefe Gedanke verankerte sich immer tiefer in seinem Bewusstsein. Als er eines Tages die Materia medica von Cullen übersetzte und von der Chinarinde las, war er von den vielfältigen und widersprüchlichen Hypothesen überrascht, die zur Erklärung ihrer Wirkung aufgestellt wurden. Er entschloss sich, durch sich und an sich selbst die Eigenschaften dieser für die Heilung zahlreicher Krankheiten so wertvollen Kraft zu ergründen. Zu diesem Zweck nahm er etliche Tage hindurch starke Dosen von Chinarinde ein und spürte schon bald die Symptome eines Wechselfiebers.
Hahnemann reagierte wahrscheinlich besonders empfindlich auf die Chinarinde. Diesem glücklichen Zufall verdanken wir das Entstehen der Homöopathie. Ebenso wie Newton, als er den Apfel zu Boden fallen sah, eine geniale Verbindung herstellte: die Chinarinde verursacht dasselbe Leiden wie jenes, das sie heilt. Dieser Versuch, den er wiederholt an sich selbst erprobte, erschien ihm beweiskräftig. Aber war das ein Einzelfall? Hahnemann begann nun an sich selbst und an einigen ergebenen Personen mit Quecksilber, der Tollkirsche, dem Fingerhut und Kockelskörnern zu experimentieren. Diese Vorgangsweise nannte er Pathogenese. Überall glaubte er eine einzige gleiche Antwort zu erhalten. So hatte er keinen Zweifel mehr. Ein großes therapeutisches Gesetz war gefunden, und somit konnte die Wissenschaft auf einer festen Basis aufbauen; seither besitzt diese Kunst einen sicheren Führer. Die natürliche und echte Beziehung, die das Medikament untrennbar mit der Krankheit verbindet und umgekehrt, war entdeckt. Hahnemann war auf den Spuren von Paracelsus, ohne sich vielleicht je eingehend mit ihm beschäftigt zu haben. Er gab dem similia similibus eine allgemeine Bedeutung. Damals führte Hahnemann zwei “Diathesen” (Krankheitsanlagen) ein, die Sykosis und die Psora. Die Sykosis entstand seiner Meinung nach durch Infektionsrückstände, vor allem von Geschlechtskrankheiten. Später stellten sich die Homöopathen gegen die Pockenimpfung und danach gegen alle Impfstoffe. Das Heilmittel gegen Sykosis war die Thuja. Ihre Darstellung entspricht ihrer Pathogenese. Sie befällt vorzugsweise die Haut, die Schleimhäute und das Nervensystem. Die Homöopathen sehen in einer fetten warzenartigen Haut und einer Fettleibigkeit vor allem um die Hüften eine krankhafte Veranlagung dazu.
Die Psora ist ein umfassendes Gebiet, in dem, wie Max Tetau es formuliert, alles zusammengeschlossen wird, was nicht zur Sykosis zählt. Hier findet man nicht nur die Krätze, sondern von ihr unabhängig eine Gesamtheit von Krankheiten, die durch eine hervorstechende Eigenart der Haut und durch krankhaftes Hin- und Herschwanken gekennzeichnet ist, das manchmal das Knochen- und Gelenksystem, manchmal verschiedene innere Organe befällt.
Zur selben Zeit sprechen die Allopathen vom Arthritismus. Später sollten auch die Begriffe Tuberkulinismus und Cancerinismus geschaffen werden.
Im Laufe der ganzen Geschichte der Medizin trifft man immer wieder auf diese Vermengung von wirklichen Beobachtungen und mehr oder weniger kontrollierbaren Hypothesen. Welches Schicksal war diesen Theorien, die von da an in die Therapie aufgestellt wurden, beschieden, wie sah ihre Zukunft aus?
Hahnemann musste sich mit tausenderlei Quälereien abfinden, die immer mühseliger zu ertragen waren. Familiäre Sorgen, der völlige Bruch der Verbindungen zu seinen Arztkollegen, von denen ihm einige teuer waren, und niedrige Verleumdungen versetzten seiner Feinfühligkeit und seinem Gewissen harte Schläge. Das alles ließ ihn an sich selbst und an seiner Entdeckung zweifeln. Selbst die Apotheker scheuten sich nicht, die Schutzgesetze ihres Berufsstandes gegen ihn einzusetzen.
Hahnemann hatte es sich zur Regel gemacht, nur von ihm selbst zubereitete Medikamente zu verschreiben. Die Missgunst, der er bei jedem seiner Schritte begegnete, veranlasste ihn dazu, jeder fremden Hilfe zu misstrauen. Welcher Apotheker hätte guten Glaubens und treu jene Medikamente herstellen können, wollen oder dies verstanden, die völlig von allem, was er gelernt hatte, abwichen? Die alemannische Gesetzgebung verbot jedoch den Ärzten, selbst Medikamente auszugeben, auch wenn sie nichts dafür verlangten. Hahnemann widersetzte sich den gesetzlichen Vorschriften. Die Apotheker, die von eifersüchtigen oder von seinem Scharlatanismus ernsthaft überzeugten Ärzten unterstützt wurden, verfolgten ihn mit dem Gesetzbuch in der Hand von Georgenthal, wo er zum erstenmal Homöopathie anwandte, bis Braunschweig, von Königslutter bis Hamburg und von Eilenburg bis Torgau. So war er bis 1811 Landfahrerarzt; schließlich kam er zum drittenmal nach Leipzig, wo er bis 1820 in einem Klima weit größerer Toleranz unterrichtete und praktizierte.
Im Laufe dieser Landstraßenjahre, die ihm durch die gemeinsame Feindschaft der Ärzte und Apotheker aufgezwungen worden waren, fuhr Hahnemann ohne Unterbrechung mit seinen Untersuchungen über die heilenden Eigenschaften von Heilmitteln fort. 1805 fasste er in zwei kleinen Bänden seine gesamten medizinischen Entdeckungen zusammen und veröffentlichte sie unter dem Titel Fragmenta de viribus medicamentorum positivis, sive in sano corpore observatis. 1810 gab er die erste Auflage des Organon der Heilkunst heraus, in dem er methodisch in einer großen Zusammenfassung der Lehre die einzelnen entdeckten Grundsätze darlegt. Seit dem Erscheinen des Organon war kaum ein Jahr vergangen, als er das schwierigste und wichtigste seiner Werke in Angriff nahm, seine Reine Arzneimittellehre (Materia medica). 1811 erschien der erste Band; der sechste und letzte kam erst 1821 heraus. Die Qualität seiner Arbeiten hatte jedoch die gegen ihn gerichteten leidenschaftlichen Verfolgungen nicht entwaffnet. Schließlich wurde er der täglichen kleinherzigen Angriffe müde und nahm 1820 die von Herzog Ferdinand angebotene Zufluchtstätte in Anhalt-Köthen an. Die hohe und mächtige Protektion garantierte ihm zumindest die Freiheit zu arbeiten und seine Kunst auszuüben. Hingegen war sie natürlich machtlos gegenüber Beleidigungen. Die Großen dieser Welt haben eine Vorliebe für Zauberer. Hahnemann musste nun nicht mehr gegen die Intrigen der Ärzte und die Gesetzesanrufungen kämpfen: er musste sich gegen die Erbitterung des Pöbels verteidigen. Er und die Seinen konnten die Schwelle des Hauses nicht mehr übertreten, ohne die beleidigenden Spötteleien und den vulgärsten Flüchen ausgesetzt zu sein. Es ging sogar soweit, daß sein Haus besetzt und die Fenster mit Steinen eingeschlagen wurden. Die Behörden waren gezwungen einzugreifen. Diese Ereignisse machten ihn so traurig, daß er beschloss, sein Haus nicht mehr zu verlassen; während der fünfzehn Jahre, die er in Köthen lebte, zeigte er sich nur sehr selten in der Öffentlichkeit. Es blieb ihm jedoch in seinem Einsiedlerdasein eine tiefe Freude: er wurde gelesen. Vom Organon erschien 1819 und von der Reinen Arzneimittellehre 1823 eine zweite Auflage.
Woher kam der Eifer, die Werke eines Mannes zu lesen, der von der Kritik bedenkenlos mit Beinamen wie Phantast, eingebildeter Besessener und manchmal sogar Scharlatan zerschmettert wurde? Dies ist wahrscheinlich von allen merkwürdigen Ereignissen im Leben Hahnemanns das unerklärlichste. In dem kurzen Zeitabschnitt von vierundzwanzig Jahren (1810–1834) erschienen vom Organon fünf Auflagen in deutscher Sprache; es war in alle europäische Sprachen übersetzt worden. Frankreich kannte zu Lebzeiten des Verfassers vier Auflagen dieses Werkes. Die Reine Arzneimittellehre und Die chronischen Krankheiten erlebten in einer noch kürzeren Zeit zwei Auflagen.
1830 starb Henriette Hahnemann, geb. Kuchler. Aber schon lange vorher waren Ruhe, Ruhm und Wohlstand auf die langen kummervollen Jahre gefolgt, die das Leben Hahnemanns so unruhig gemacht hatten. Die zahlreichen Heilungen, die er bewirkt hatte, die Achtung, die ihm von bedeutenden Männern aus allen Ländern gezollt wurde, die in seiner Behandlung Hilfe gesucht hatten, konnten dem großen Mediziner eine glückliche Entschädigung für alle erlittenen Ungerechtigkeiten bieten.
Am 18. Januar 1835, im Alter von neunundsiebzig Jahren, heiratete er in zweiter Ehe Fräulein Mélanie d’Hervilly, eine Französin, die zu ihm zur Behandlung nach Köthen gekommen war. Er entschloss sich, Deutschland zu verlassen und nach Paris zu übersiedeln, wo seine Lehre langsam bekannt wurde. Am 21. Juni 1835 kam Hahnemann in Paris an. Hier praktizierte und heilte er mit unbestreitbarem Erfolg als homöopathischer Modearzt, und sein Ruhm wuchs ständig an. Trotz seines hohen Alters blieb ihm bis zu seinen letzten Tagen seine geistige Willenskraft, eine einzigartige Aktivität und eine robuste Gesundheit erhalten, die es ihm erlaubte, sich jeden Tag beständig seiner Arbeit zu widmen. Gegen Ende des Winters 1843 begann sein Gesundheitszustand schwächer zu werden. Er starb am 2. Juli desselben Jahres mit der Gewissheit, daß sein Lebenswerk weitergeführt und vervollkommnet werde.
Albert Einstein
aus: Lexikon der Naturwissenschaftler. Red.: Rolf Sauermost, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2000 (bei Amazon bestellen).
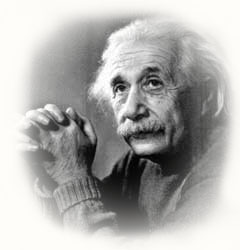
Albert Einstein
Einstein, Albert, deutsch-schweizerisch-amerikanischer Physiker, *14.3.1879 Ulm, † 18.4.1955 Princeton (N.J., USA); einer der bedeutendsten theoretischen Physiker und eines der größten wissenschaftlichen Genies aller Zeiten; besuchte in München das Gymnasium, siedelte 1894 in die Schweiz über und machte in Aarau das Abitur; studierte an der Eidgenössischen TH in Zürich Mathematik und Physik (Studienabschluss 1900), erhielt 1901 die schweizerische Staatsbürgerschaft;
1902-09 Mitarbeiter am schweizerischen Patentamt in Zürich,
1905 Doktor der Philosophie an der Universität Zürich, erhielt
1908 die Lehrbefugnis für theoretische Physik an der Universität Bern und
1909 einen Lehrstuhl an der TU Zürich,
1911-12 Professor an der deutschen Universität in Prag, danach wieder in Zürich;
1914 zum ordentlichen Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften gewählt, übersiedelte 1914 nach Berlin,
1914–34 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik in Berlin. Nach Hitlers Machtübernahme kehrte Einstein, der jüdischer Herkunft war, von Lehrveranstaltungen in den USA nicht mehr nach Deutschland zurück und legte seine Ämter am Kaiser-Wilhelm-Institut und an der Preußischen Akademie der Wissenschaften nieder;
1933 erhielt er eine Professur am Institute for Advanced Study in Princeton und wurde
1940 amerikanischer Staatsbürger (Deutschland hatte ihm 1934 das Bürgerrecht entzogen).
Einstein entfaltete, namentlich 1905 bis Ende des Ersten Weltkriegs, eine vielseitige Forschertätigkeit, die ihn als einen der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts kennzeichnet.
1905 veröffentlichte er die spezielle Relativitätstheorie, die von zwei Grundannahmen ausgeht (spezielles Relativitätsprinzip, dargestellt in “Zur Elektrodynamik bewegter Körper”): von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit sowie von der Lorentz-Transformation, die Bewegungsgleichungen für raumfeste Bezugssysteme angibt (danach sind die physikalischen Gesetze in allen gleichförmig und geradlinig zueinander bewegten Koordinatensystemen gleich).
Auf der Basis dieser Annahmen folgerte Einstein, daß es eine Zeitdilatation, eine Längenkontraktion des vierdimensionalen Raumes und eine Äquivalenz von Masse und Energie (1907; Einstein-Gleichung) gebe; dies hatte grundlegende Neuorientierungen in Physik und Astronomie zur Folge.
1916 veröffentlichte er die allgemeine Relativitätstheorie, in der er unter anderem das empirische Äquivalenzprinzip der Gleichheit von schwerer und träger Masse sowie neue Feldgleichungen der Gravitation formulierte und darlegte, daß die Raumgeometrie durch die Materie bestimmt wird (Machsches Prinzip); daraus folgten das Postulat einer Raumkrümmung in der Nähe großer Massen (z.B. der Sonne) und die Vorhersage der Ablenkung des Sternlichts bei dessen Passage in der Nähe des Sonnenrands; dieser Effekt wurde von A.S. Eddington 1919 bei der Beobachtung einer Sonnenfinsternis bestätigt;
1917 begründete Einstein die relativistische Kosmologie, die Lehre vom unbegrenzten, aber räumlich endlichen Weltall.
Andere wichtige Untersuchungen betreffen insbesondere die Theorie der Brownschen Molekularbewegung (1905; Einstein-Relation), die Quantentheorie (1905 Lichtquantenhypothese, 1907 Theorie des lichtelektrischen Effekts und der spezifischen Wärme der Festkörper, 1912 Herleitung des photochemischen Quantenäquivalentgesetzes [Einsteinsches Äquivalentgesetz, Stark-Einstein-Prinzip]), den Einstein-de-Haas- Effekt (1915), die Bose-Einstein- Kondensation und Bose-Einstein-Statistik (1924/25).
1921 erhielt Einstein den Nobelpreis für Physik – bemerkenswerterweise nicht für die Entwicklung der Relativitätstheorie, sondern für seine Beiträge zur Quantentheorie, insbesondere die quantentheoretischen Arbeiten zum Photoeffekt. In Princeton versuchte Einstein, eine vereinheitlichte Feldtheorie der Gravitation und des Elektromagnetismus zu entwickeln; er veröffentlichte 1953 eine solche Theorie mit vier Grundgleichungen, die bis heute ein Hauptthema der Quantenphysik sind.
Vor und während des Zweiten Weltkriegs setzte er sich für Friedensbemühungen ein, wies aber den amerikanischen Präsidenten Roosevelt (zusammen mit E. Fermi und N.H.D. Bohr) auch auf die Möglichkeit zur Herstellung einer Atombombe hin.
Nach Einstein sind ferner benannt das künstliche radioaktive Element aus der Reihe der Actinoide mit der Ordnungszahl 99 (Einsteinium), der Einstein-Kosmos (“Zylinderwelt”) und Einstein-Ring, das Einstein- Observatorium (ab 1979 – anläßlich des 100. Geburtstags von Einstein – Bezeichnung des amerikanischen Röntgensatelliten HEAO‑2) und der Einstein- Turm (Bezeichnung des 1920–21 erbauten Sonnenturms des Zentralinstituts für Astrophysik in Potsdam-Babelsberg).
Autor
• Rainer H. Bubenzer, Heilpflanzen-Welt (2005)
weitere Infos
• Hahnemann: Begründer der Homöopathie
• Homöopathie: Hochwirksam und effektiv
• Umstimmung – oder wie der Geist aus der Medizin verschwand
• Die Spagyrik des Theodor Krauß als Fortführung der Mattei’schen Elektrohomöopathie