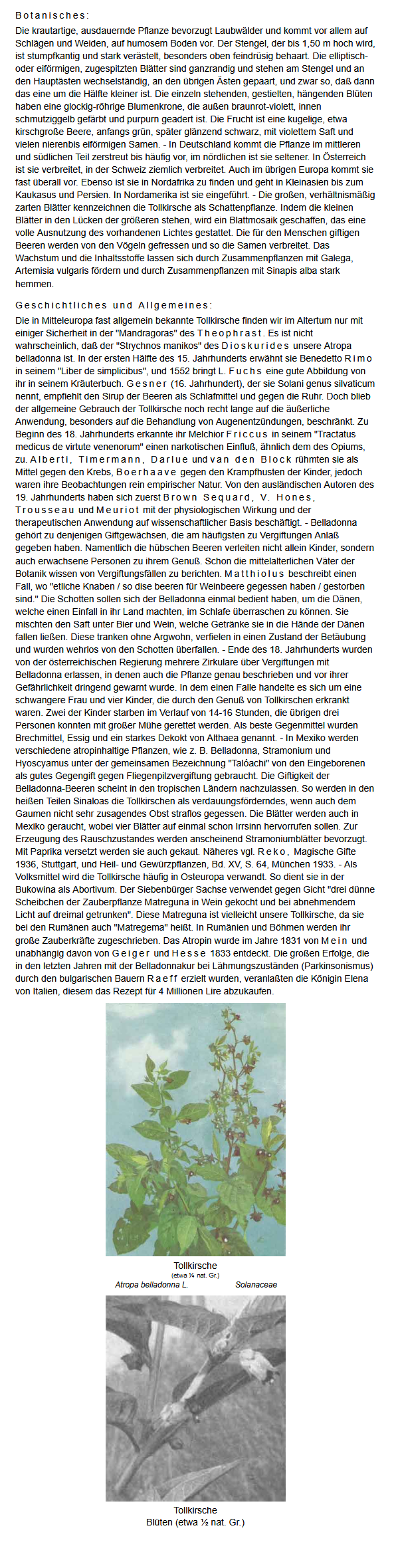
Gerhard Madaus: Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Verlag Georg Thieme, Leipzig, 1938
(Original, vollständig erhalten) – bei eBay zu verkaufenRezension 1938, Archiv der Pharmazie
Die Welt der Heilpflanzen
Gerhard Madaus: Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Verlag Georg Thieme, Leipzig, 1938
(Original, vollständig erhalten) – bei eBay zu verkaufenRezension 1938, Archiv der Pharmazie